Stadtbefestigung und Tore
Unvollendete Pläne und was davon übrig blieb
|
Freudenstadt besaß lange Zeit
keine Stadtmauer. Sie war zunächst auch nicht notwendig, denn das
"Bollwerk" gegen den potentiellen Feind bildete
zunächst die Herrschaft Oberkirch, das 1604 als
Pfandschaft übernommen wurde.
Als Herzog Friedrich 1608
gestorben war, beauftragte sein Sohn, Johann Friedrich
(1608-1628), Baumeister Schickhardt einen Plan für die
fehlende Schutzwehr zu erstellen. Dessen Plan von 1612
(siehe die kleine Skizze)
wurde nur in Stücken umgesetzt und nie fertiggestellt.
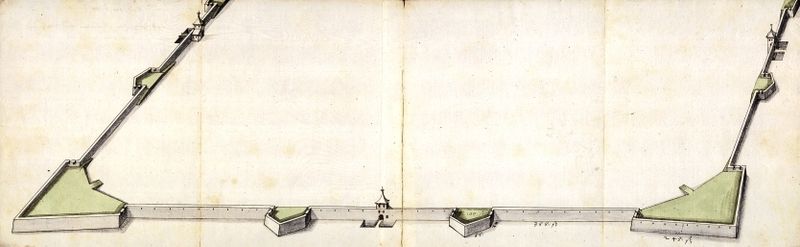
Verschiedene Hindernisse,
wie z.B. die Wasserzuführung durch die
Teuchelleitungen, vereitelten den Bau einer Mauer.
1627 unternahm
Schickhardt einen neuen Anlauf mit dem Bau von Wall und
Graben. Der Untergrund versprach aber nicht genügend
Stabilität, sodass 1628 Schickhardt auch eine geringere
Mauerumwallung aufgab und empfahl nur noch Graben und
Brustwehr zu errichten.
 So
kam Freudenstadt zunächst nur zu dem sogenannten
"Plankenzaun", der auf dem Merianstich von 1643 gut zu
erkennen ist.
(1)
So
kam Freudenstadt zunächst nur zu dem sogenannten
"Plankenzaun", der auf dem Merianstich von 1643 gut zu
erkennen ist.
(1)
Die Pfandschaft Oberkirch ging aber im
30-jährigen Krieg zeitweilig (1634-1648) wieder an den
Bischof von Straßburg verloren. Zwar wurde sie im
Westfälischen Frieden wieder an Württemberg gegeben,
aber die Pfandsumme wurde nicht aufgebracht und so
stand 1662 fest, dass Oberkirch wieder an Straßburg
fallen würde.
Damit verlor es seine Funktion als
"Schirmmauer" für Freudenstadt und die Westgrenze des
Herzogtums.
So kam es unter Eberhard III. zu neuen
Überlegungen Freudenstadt eine "Wehr" zu geben. Zwei
Ansätze wurden gleichzeitig verfolgt. Erstens wurde
1666 der Palisadenzaun, der im Krieg wohl stark
gelitten hatte, erneuert und dazu vier Torhäuser aus
Holz gebaut.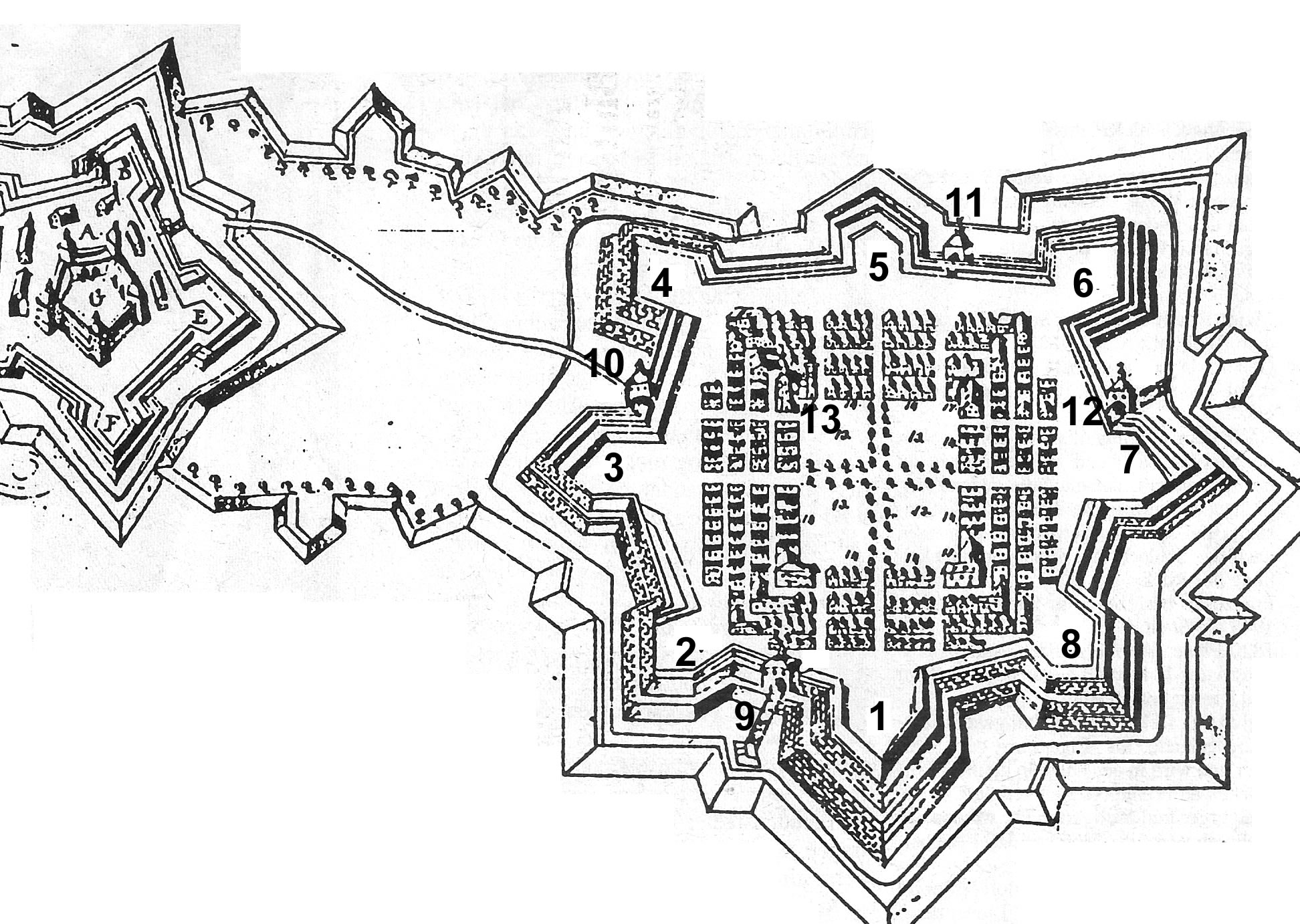
Gleichzeitig aber plante man eine neue großzügige
Festungsanlage mit zusätzlicher Zitadelle auf dem
Kienberg. Diese sollte mit einem speziell verschanzten
Weg mit der Stadt verbunden werden. Sie war als
zusätzliche Sicherung (Nebenfestung und Rückzugsort)
gedacht, da die Gräben allesamt nicht als Wassergräben
angelegt werden konnten. - Siehe linkes Bild.
Herzog Eberhard wollte mit dieser
Sicherung der Stadt wieder neue Bürger gewinnen. Denen
versprach er zwölf Jahre Steuerfreiheit.
Damit die Altbürger blieben, wurde diesen sechs Jahre
Steuerfreiheit zugesagt. Es gab verbilligte Bauplätze,
Bauholz wurde verschenkt., Ämter wurden nach dem Krieg
wieder besetzt, kurzum Freudenstadt sollte wieder
aufblühen. Durch die Pestwellen und durch die Folgen
des Krieges hatte die Einwohnerzahl sehr gelitten.
Viele Bürger hatten die Stadt verlassen. Ihnen war die
Stadt zu unsicher geworden.
Im Jahr 1667 ließ Herzog Eberhard III.
endlich nach den Ideen des Ingenieurs d'Avila mit dem
Bau der gewaltigen Festungsanlage beginnen. Jakob
Alfons Franz Calderon d’Avila, 1625-95, war
ursprünglich spanischer Adeliger, ausgebildeter
Ingenieur, Architekt und Festungsbaumeister im Dienste
des Herzogs.
Die
Bauleitung hatte Matthias Weiß (1636-1707), (4) unterstützt wurde er von Georg Ludwig Stäbenhaber.
Dieser war seit 1669 der herzogliche
Festungsbaumeister, der auch 1674/75 die Instandsetzung
der Kniebisschanzen leitete.
Bekannt wurde er durch die Karte des Freudenstädter
Forsts von 1675. Wegen der hohen Genauigkeit der Darstellung ist diese
Karte heute ein wertvolles historisches Dokument.
Gebaut wurde bis
1674. Da starb Herzog Eberhard III. und der Weiterbau
wurde sofort eingestellt. Auch die links dargestellte Zitadelle auf dem Kienberg
wurde nicht gebaut.
(1)
Der Nachfolger, Herzog Wilhelm
Ludwig, ließ durch seinen Oberstleutnant Andreas Kieser
ein Gutachten über die Zweckmäßigkeit der Festung
erstellen.
Dieser fand nur Argumente, die gegen die
Festungsanlage sprachen und damit fiel es dem neuen
Herzog leicht, das teure Projekt sofort zu beenden.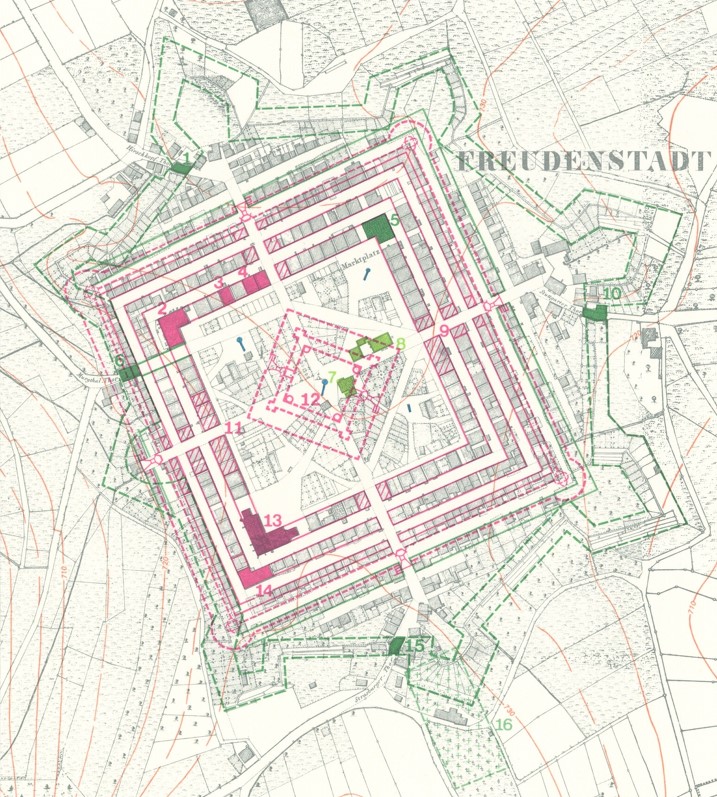
 Die
bis dahin bestehenden Mauern und die schon behauenen
Steine dienten der Bevölkerung
nun als Baumaterial für ihre Häuser.
Die
bis dahin bestehenden Mauern und die schon behauenen
Steine dienten der Bevölkerung
nun als Baumaterial für ihre Häuser.
Aus Gräben und
Wällen wurden wieder Gärten und Weiden für das
Kleinvieh. Einzelne Teile wurden auch an die Bürger
verpachtet. Bald war alles neu überbaut und
damit das Gesamtbild der "Festungsstadt" völlig
verändert.
Die links abgebildete Darstellung von H. Bannasch
(3)
verdeutlicht, wie der Ausbau der "Festungsstadt
Freudenstadt" geplant war.
Auch die Lage der vier Stadttore ist deutlich zu
erkennen.
Die Bilder der Tore im Großformat
befinden sich in der Bildergalerie: "Geschichtliches".
Leider gibt es kaum Bildmaterial zu dem damals
erreichten Bauzustand. Aber es existieren
Beschreibungen, vor allem der vier Tore in der
Beschreibung des Oberamts Freudenstadt von 1858.
(5)
Sie
wurden mit dem heimischen roten Buntsandstein gebaut,
den der nahegelegene Steinbruch (heute neben dem
Facharztzentrum in der Straßburger Straße) lieferte.
Ich habe die Standorte der Tore auf eine aktuellen
Karte der Freudenstädter Innenstadt (nebenstehend)
übertragen, damit man sich ein Bild von ihrer damaligen
Lage machen kann. Ihre Standorte markieren noch heute
die wichtigsten Verkehrsanbindungen von und nach
Freudenstadt. Genau deshalb sind die Tore
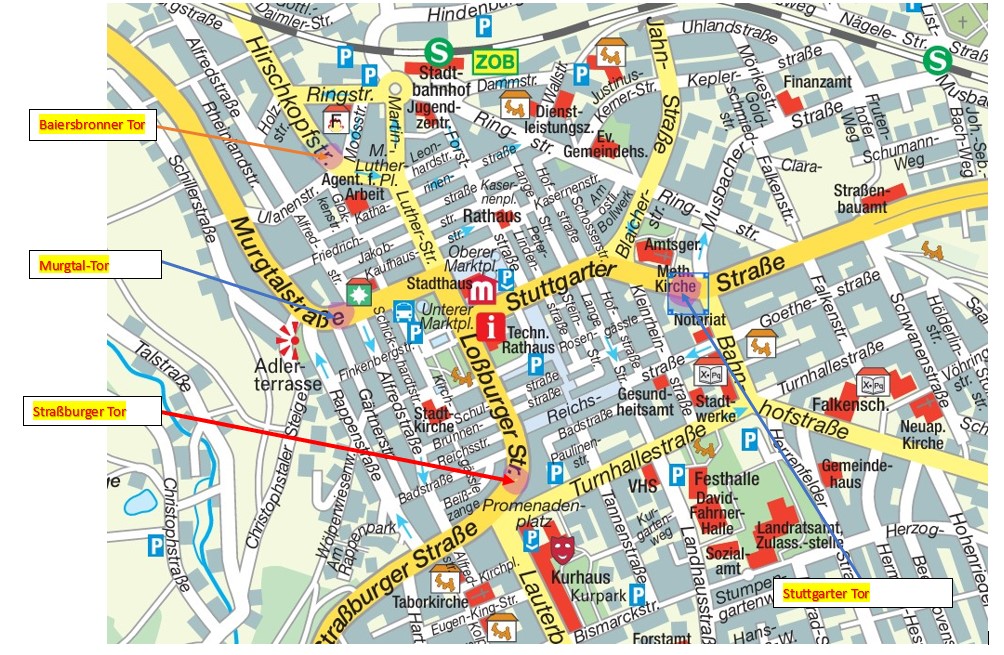 verschwunden;
sie standen dem zunehmenden Straßenverkehr im Wege.
verschwunden;
sie standen dem zunehmenden Straßenverkehr im Wege.
Die einzige Abbildung aller vier Tore hat uns
Manfred Eimer überliefert.
(2)
Das Stuttgarter Tor (Reihe: 1-links) abgebildet) im Osten war mit aus Stein gehauenen Kanonen- und Mörserläufen verziert und trug die herzogliche Inschrift E.H.Z.W. 1668 (für Eberhard Herzog zu Württemberg) sowie das württembergische und dettingsche Wappen. Es beherbergte außerdem oberamtgerichtliche Gefängnisse.
Das
Straßburger Tor (auch Loßburger- oder Süd -Tor)
genannt - (Reihe:2. vom links) im
Süden war
weniger reich verziert und erhielt dieselben Wappen
und die Inschrift 1678. Über dem Torbogen befand
sich eine vermietete Wohnung und jeweils ein Gefängnis
des Oberamts und des Oberamtsgerichts.
Das
Murgtal-Tor
(Reihe: 2. von rechts) im
Westen umfasste die
Wohnung des Oberamtsdieners und zwei Gefängnisse des
Oberamts Freudenstadt. Die Inschriften lauteten:
E.H.Z.W. 1631 auf der Außenseite und F.C.H.Z.W. 1681
auf der Innenseite. Dies entspricht den Initialen von
Friedrich Carl, dem Vormund von Herzog Eberhard Ludwig.
Das Hischkopf-Tor,
auch Baiersbronner Tor
genannt - (Reihe: ganz
rechts) im
Norden war
mit der Jahreszahl 1622 beschriftet und war das älteste
der vier Stadttore. Dort waren die Wohnung des
Oberamtsgerichtsdieners sowie drei Gefängnisse des
Oberamts untergebracht. Wenn wir von bis zu drei
Gefängnissen im Stuttgarter Tor ausgehen, dann
existierten in den Toren insgesamt zehn Gefängnisse,
bzw. Gefängniszellen. Wurde diese erstaunlich große
Anzahl wirklich gebraucht? Allerdings müssen wir
berücksichtigen, dass die meisten Zellen für das
"Oberamt" also für einen ganzen "Bezirk" vorgesehen
waren. Offensichtlich sah man es für notwendig an,
soviel Gefängnisraum bereitzustellen.
1820 wurde überlegt,
die "Festung Freudenstadt" zu einer Bundesfestung
auszubauen. Man entschied sich aber dagegen und deshalb
wurden 1870 die Stadttore zum Abriss verkauft und die
Reste der Festung dem endgültigen Verfall preisgegeben.
Zehn Jahre später war nur noch der Festungsdamm beim
heutigen Stadtbahnhof einigermaßen erhalten. Der zugehörige Wall
ist heute noch bei der Friedenskirche zu erkennen.
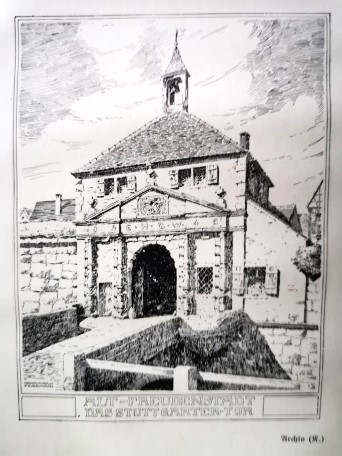
|
 |
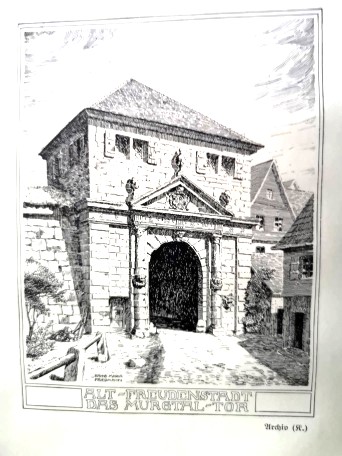 |
 |
Was ist von all diesen markanten Bauwerken übrig geblieben? Die einzigen Fragmente stammen vom Straßburger (=Loßburger) Tor. Sie sind im Besitz der Kreissparkasse und wurden von dieser saniert. Man findet sie im Eingangsbereich der Stuttgarter Straße 29.
Links unten dazu ein Bild von und aus Google-Street-View.
Das Loßburger Tor wurde 1861 durch den Stadtbaumeister Wälde abgebrochen, weil es der Verlegung einer neuen Wasserleitung im Weg stand. Aber er nutzte vom Abbruchmaterial Ziersteine, zwei Vasen und zwei Fratzen mit Gucklöchern für die Säulen des Hoftores an seinem Wohnhaus. Die Fratzen sind auch auf dem Torbild von M. Eimer zu erkennen.
Ein Wappenstein mit Fratze wurde als einziger Rest des früheren Loßburger Tors in die Wand des Kurhauses eingesetzt. Es befindet sich an der langen Galerieseite außen (Lauterbadstraße). Es zeigt links das Wappen von Herzog Eberhardt (württembergische Hirschstangen, Rauten von Teck, Reichssturmfahne und die Barben von Mömpelgard). Rechts ist das Wappen seiner Frau, Maria Dorothea Sofie, geb. Gräfin von Öttingen.
Der Gasthof "Zur Burg" (unteres Hinweisschild), bei dem das Straßburger Tor einst stand, gibt es heute nicht mehr. Er befand sich in dem heutigen Gebäude der Volksbank, Loßburger Straße 23.
Die stilisierte Abbildung auf dem Hinweisschild mit dem Glockentürmchen weist eher auf das Stuttgarter Tor hin und nicht auf das Loßburger Tor, das kein Glockentürmchen hatte.
 |
|
 |
 |
Neuste Technik mit Künstlicher Intelligenz ermöglicht es uns heute anschauliche Bilder der Tore nachträglich zu erstellen. Wir können hier nachvollziehen, wie die Tore ungefähr ausgesehen und welche Wirkung sie auf die Besucher der Stadt gehabt haben.
Natürlich stimmen dabei nicht alle Details, doch der Gesamteindruck dürfte annähernd erreicht sein. Im Vergleich dazu ein Tor aus Soest um 1525 - siehe obere Reihe ganz rechts.
Die Bilder kann man im Großformat anschauen, wenn man sie mit der rechten Maustaste anklickt und die Option wählt: Bild im neuen TAB öffnen.
 |
 |
 |
 |
Es existiert eine Lithographie von Friedrich Bothner nach F.Schnorr von 1837, die Freudenstadt von der Suedwestseite zeigt und auf der die Stadttore (noch) zu erkennen sind.
 |
Auf der Ausschnittsvergrößerung sind die Tore markiert - von links nach rechts: Murgtal - Baiersbronner - Loßburger - Stuttgarter - Tor.
Der alte Friedhof befand sich damals noch unterhalb des Loßburger (Straßburger) Tors. Siehe rechter Rand.
 |
Für eine vergrößerte Ansicht: Rechte Maustaste - Bild im neuen TAB öffnen!
Letzte Änderung: 14.07.2025
Quellen:
Wikipedia
Manfred Eimer: Geschichte der Stadt Freudenstadt, Oskar Kaupert, Freudenstadt, 1937-
Alle Torbilder sind hier zu finden. https://www.leo-bw.de/detail-gis/-/Detail/details/DOKUMENT/kgl_atlas/HABW_04_11_Freudenstadt/Grundrisse+neuzeitlicher+St%C3%A4dte+II%0AFreudenstadt
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6829/1/Klaiber_Der_fuerstlich_wuerttembergische_Baumeister_Matthias_Weiss_1929.pdf
https://de.wikisource.org/wiki/Beschreibung_des_Oberamts_Freudenstadt/Kapitel_B_1
Freudenstädter-
Marktplatz-Geschichten
Abschnitt 1_2:
Stadtbefestigung und Tore
Nächster Abschnitt: 1_3:
Stadt im Quadrat
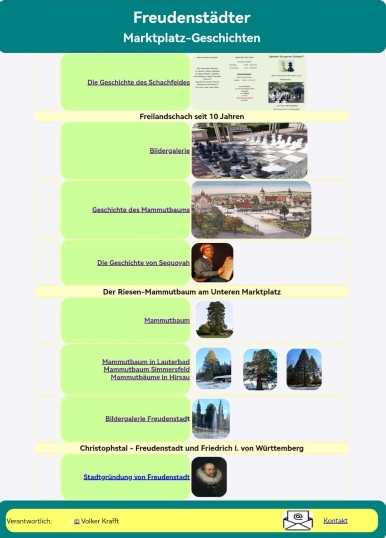
Verantwortlich: © Volker Krafft