Friedrich (1557-1608) und Sibylla (1564-1614)
Szenen einer Ehe
|
Am 17. April 1580 trat Friedrich in Begleitung seines Stallmeisters, seines Sekretärs und zwölf Dienern seine Reise durch Böhmen und Sachsen bis nach Dänemark an. Erst am 25. August traf er wieder in Stuttgart ein. Diese Reise war unter anderem als Brautschau angelegt. Bis dahin waren für Friedrich schon eine französische Prinzessin aus dem Haus Vaudemont, die Witwe des Prinzen von Conde, die Prinzessin Sibylla von Jülich und Maria, die Tochter des Herzogs von Braunschweig, als mögliche Heiratskandidatinnen ausgesucht worden.
 Er lernte aber
jetzt auch Sibylla von Anhalt kennen, die
Tochter des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt. Nicht ganz unbeteiligt daran
war die Tochter Eleonore des württembergischen Herzogs Christoph. Diese war
nämlich als zweite Frau von Fürst Ernst von Anhalt die Stiefmutter von
Sibylla geworden, nachdem deren Mutter, Agnes von Barby, 1569 gestorben war. Eleonore wird
nachgesagt, dass sie eine sehr fürsorgliche "Ersatzmutter" für Sibylla gewesen sei.
Er lernte aber
jetzt auch Sibylla von Anhalt kennen, die
Tochter des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt. Nicht ganz unbeteiligt daran
war die Tochter Eleonore des württembergischen Herzogs Christoph. Diese war
nämlich als zweite Frau von Fürst Ernst von Anhalt die Stiefmutter von
Sibylla geworden, nachdem deren Mutter, Agnes von Barby, 1569 gestorben war. Eleonore wird
nachgesagt, dass sie eine sehr fürsorgliche "Ersatzmutter" für Sibylla gewesen sei.
Sibylla (geb. 28.09.1564) wurde auf Druck ihres Vaters im Jahr 1577 zur Äbtissin des freien, weltlichen Stiftes Genrode und Frose (in Sachsen-Anhalt) vorgeschlagen und von Kaiser Rudolf II im Amt bestätigt.
Vorher hatte ihre ältere Schwester Anna Maria dieses Amt inne, nach ihr folgten ihre jüngere Schwestern Agnes, Hedwig, und Dorothea Maria als Äbtissinnen.
Sibylla kam also mit 13 Jahren in dieses Amt und legte es 1581 wieder nieder, als die Ehe mit Friedrich arrangiert wurde.
Als Heiratsgut brachte sie 15 000 Thaler oder 17 250 Rheinische Gulden mit, Friedrich verbürgte für dem Fall einer Witwenschaft die Herrschaft über Reichenweier und das Städtchen Beilstein, nebst 300 Gulden "Morgengabe". Ursprünglich diente die "Morgengabe" der finanziellen Absicherung der Frau. Heute ist sie meist ein symbolisches Geschenk, das die Liebe und Verbundenheit des Paares ausdrücken soll. Außerdem musste Sibylla versprechen in Kirchen-Sachen keinerlei Änderungen vorzunehmen.
Die Vermählung fand am 13. November 1580 statt, das "Beilager" wurde am 23. Mai 1581 in Stuttgart vollzogen, da war sie noch keine 17 Jahre alt.
Friedrich, der bisher unter der Vormundschaft von Herzog Ludwig stand, trat nun sein Grafenamt an und reiste von Stuttgart nach Mömpelgard. Herzog Ludwig begleitete ihn und seine junge Frau dorthin. Am 4. Juli reiste er zurück nach Stuttgart, nicht ohne seine vorherige "vetterliche Erinnerung" an Friedrich: Dieser...
--- möge sein Amt in Gottesfurcht
führen, mit Gnadenbezeugungen nicht allzu freizügig sein, sich davor hüten,
Schulden zu machen und nicht mehr ausgeben als er einnehmen könne. Er solle sich
nicht in fremde Händel einmischen und schlechte Bündnisse eingehen und vor
allem solle er sich zu keinem Unwillen gegen ihn, den Herzog, verleiten lassen.(1,
Seite 70/71)
Sibylla wird als besonders anmutig und wohlgestaltet beschrieben, außerdem sei sie durch ihren scharfen Verstand aufgefallen. Beide Eheleute fühlten sich auch körperlich voneinander angezogen, es war wohl zunächst eine Liebesheirat und Sibylla wurde in den nächsten 15 Jahren Mutter von 15 Kindern, von denen zehn das Erwachsenenalter erreichten.
Das erste Kind war "Johann Friedrich" (*05.05.1582), Friedrichs Nachfolger ab 1608, das letzte "Anna" (*15.03.1597), da war Sibylla gerade mal 33 Jahre alt. Danach versiegte der Kindersegen. Die Umstände sprechen dafür, dass sich Sibylla ab diesem Zeitpunkt ihrem Mann verweigerte oder ihr Mann nur noch Gefallen an seinen Mätressen fand.
 Aber sie war bis dahin schon zur "Stammmutter" der
nachfolgenden württembergischen Herzogslinien geworden. Das betraf die
Linien Mömpelgard, Winnental und Neuenstadt, Weitingen und Oels, Teck, das
Haus Urach und die königliche Linie sowie das Haus Württemberg von heute.
Aber sie war bis dahin schon zur "Stammmutter" der
nachfolgenden württembergischen Herzogslinien geworden. Das betraf die
Linien Mömpelgard, Winnental und Neuenstadt, Weitingen und Oels, Teck, das
Haus Urach und die königliche Linie sowie das Haus Württemberg von heute.
Es muss zu diesem Zeitpunkt eine große "Zerrüttung" zwischen den Ehepartnern entstanden sein, denn von da an lebten sie getrennt und im Zwist, der laut Chronisten, Hertel (8) und Wikipedia erst kurz vor dem Tod Friedrichs 1608 "beigelegt" wurde.
Sibyllas Leben war von Friedrich zu der Rolle der "Frau als Gebärmaschine" reduziert und letztlich durch eine 15-jährige "Dauerschwangerschaft" sehr eingeschränkt worden.
Ihr Leben war zuletzt eine Kette von solchen Widerwärtigkeiten und Kränkungen, dass sie oft sagte, sie glaube nicht, dass irgend einer ihrer Untertanen sein Kreuz und Herzeleid mit dem ihrigen vertauschen würde.
"Aber die edle Frau ertrug alles mit beispielloser Geduld, schickte sich mit sanfter Nachgiebigkeit in die Launen ihres Gemahls und suchte durch die wärmste Zärtlichkeit dessen Liebe wieder zu gewinnen; doch alle ihre Bemühungen waren umsonst."(1)
Diese Charakterisierung findet man bei allen Chronisten.
Sibylla lebte bis 1593 in Mömpelgard und nach Friedrichs Amtsübernahme am Hof in Stuttgart. Schon in Mömpelgard hatte sie erleben müssen, dass Friedrich nichts von ehelicher Treue hielt, als er sich dort mit einer Wäscherin namens "Madeleine" einließ und diese 1593 auch mit nach Stuttgart nahm. (Hertel in 8, Seite 78), P. Sauer in 12, Seite 167, 172)
Am Hof in Stuttgart wurde es nicht besser - im Gegenteil: Drei Damen in Diensten des Hofes wurden von Friedrich als "Kupplerinnen" beauftragt, ihm weitere Mätressen zuzuführen. (4)
Sabine Scheyhing diente bis 1602 vier Jahre lang der Herzogin Sibylla persönlich, Ursula Dorothea Linder, eine Pfarrerstochter, wurde im August 1596 als Säugamme an den Hof berufen und Margaretha Huber (Matthiä) war etliche Jahre Hofköchin gewesen. Alle drei wurden vom Herzog neben ihren eigentlichen Aufgaben mit Kuppeldiensten beauftragt.
Insgesamt wurden nach Friedrichs Tod sechs Kupplerinnen verhaftet, wobei zwei von ihnen eine "mildere" Behandlung erfuhren, nämlich Anna Maria im Harnischhaus (das "Zeughaus" in Stuttgart, das von Herzog Christoph 1567 errichtet worden war). Sie war die Ehefrau von Hans Jacob Stählin, laut Ruth Blank ein "Trabant" von Herzog Friedrich.(4), Anmerkung Harnischhaus***
Die zweite war die im Beitrag "Stadtgründung" schon erwähnte Freudenstädter Schulmeisterin Ketterlin, die wohl eher eine "Liebschaft" des Herzogs und weniger Kupplerin gewesen war. (Nicht in allen Quellen wird zwischen den Kupplerinnen und den Mätressen des Herzogs genau unterschieden, deshalb findet man auch die Zahl von 8 "inhaftierten" Kupplerinnen.)

Sabine Scheyhing, die erste der oben genannten Hofdamen, war mit Ludwig Scheying verheiratet, der seit ca. 1605 als Hausschneider und Bauverwalter auf Schloss Hellenstein bei Heidenheim arbeitete. Dort wurde Sabine 1608 verhaftet und in Gefangenschaft gehalten, ihr Mann vom Dienst beurlaubt. Herzog Johann Friedrich hatte den Herrn von Remchingen nach Hellenstein geschickt und alle Schreiben, die sie vom Herzog Friedrich besitze, "abfordern" lassen. Dabei wurde eine strenge Hausdurchsuchung vorgenommen. Im April 1608 wurde Sabine Scheying in Hohen-Urach eingekerkert und am 17. Februar 1609, nachdem sie "Urfehde" geschworen hatte, entlassen.

Ursula Dorothea Linder, die Säugamme, wurde wenige Stunden nach Friedrichs Tod am 30. Januar 1608 verhaftet, obwohl sie hochschwanger war. Ihr Ehemann, Christoph Linder verlor seine Stellung als Bauverwalter und Lichtkämmerer auf Hohen Tübingen und wurde zehn Tage später, am 9. Februar verhaftet. Am 28. Mai wurden beide wegen der anstehenden Geburt vorübergehend gegen 200 Gulden entlassen, im Juni jedoch auf eigene Kosten wieder gefangen gesetzt und zur "Urfehde" gezwungen, danach am 10. Oktober entlassen.
Margaretha Huber (Matthiä) "begleitete" den Herzog indirekt in den Schwarzwald. Bei der Stadtgründung von Freudenstadt war sie vor Ort in Klosterreichenbach, wahrscheinlich bekochte sie ihn auch während der Phase der Stadtgründung von Freudenstadt.
Sie wurde am 24.07.1604 mit Johann Matthiä, lateinischer Schulmeister in Freudenstadt (genannt "Saxo", weil er aus Sachsen stammte) verheiratet. Der Herzog schenkte ihnen zur Hochzeit einen Silberbecher und war Taufpate bei deren Tochter Anna Magdalena (04.11.1605) ! (4)(6) Deren Schicksal konnte leider nicht mehr ermittelt werden.
Der Leser möge sich selber fragen, warum der Herzog ausgerechnet bei Ihr Taufpate war. Dass seine Frau Sibylla auch dabei war, ist wenig wahrscheinlich, weil sonst Chronisten den Besuch in Freudenstadt in irgendeiner Form festgehalten hätten.
M. Eimer bemerkt: Frau Matthiä hatte sich beim Herzog sehr dafür eingesetzt, dass ihr Mann die Stelle als Organist bekommen hatte, obwohl er überhaupt nicht singen konnte. 1608 befand er sich aber schon in Dornstetten, denn dort wurde sein Sohn Hercules Felix getauft. (6)
Über die Rolle von Margaretha Matthiä wurde schon im Beitrag zur "Stadtgründung von Freudenstadt" berichtet.
Alle drei Hofdamen waren sich sicher, durch ihren Gehorsam gegenüber Friedrich in dessen Gunst zu stehen und zu bleiben, da sie ja alle auf dessen "Befehl" handelten. Nach dessen Tod aber landeten sie im Gefängnis von Hohen-Urach und verloren ihr Hab und Gut, ja ihre ganze bürgerliche Existenz. Da half es ihnen auch nicht, dass sie vor dem Reichskammergericht in Speyer gegen das Fürstenhaus klagten.
Möglicherweise verdanken die Klagenden aber der Aufmerksamkeit des Reichskammergerichtes in Speyer ihr Überleben.
Diese Aufmerksamkeit war dadurch gestärkt worden, dass nahezu zeitgleich dort ein Verfahren von Georg Esslinger (Landesprokurator unter Friedrich) gegen das Fürstenhaus Württemberg anhängig war. Dieses und der Landtag wollten an ihm ein ähnliches Exempel statuieren, wie bei Matthias Enzlin, der nach Friedrichs Tod hingerichtet wurde. Esslinger argumentierte ähnlich wie die Kupplerinnen: "Ich habe auf Befehl Friedrichs gehandelt!" Und ihm war von Friedrich Straffreiheit zugesichert worden. (9)
Schon 1604 war zudem ein Verfahren Huldenreich gegen das Herzogtum in Speyer anhängig gewesen, was die Aufmerksamkeit des Gerichts wohl noch mehr erhöht hat. Siehe den Beitrag: Stadtgründung
Außerdem sollen auch die Gattin und die Tochter des Stuttgarter Hofpredigers und Kirchenrat Dr. Georg Vitus (1561-1616) dem Herzog ihre Gunst geschenkt haben. Der gehörnte Ehemann sei nachsichtiger als "Eli" gewesen. Nach dem Tod Friedrichs verlor er zunächst seinen Posten, wurde aber später (1610) Prälat in Anhausen. (12, Seite 173)
Das alles zusammengenommen ist mehr als ein "Hoftratsch, der eifrig bemüht gewesen zu sein scheint, der Herzogin über ihren Gemahl reinen Wein einzuschenken", wie Hertel in seinem Aufsatz "Zarte Bande Herzog Friedrichs zu Freudenstadt" bemerkt und kann auch nicht mit "französischen Sitten" entschuldigt werden, denen Friedrich angeblich "nacheiferte".(8, Seite 79ff)
Vielmehr ist davon auszugehen, dass Friedrich seine Person und seine Bedürfnisse über alle moralischen und gesellschaftlichen Normen gesetzt sah.
Dies wird nicht nur durch seine Haltung gegenüber dem weiblichen Geschlecht bezeugt sondern auch durch seine Skrupellosigkeit bei der Verhängung von Todesstrafen aller Art. Man denke nur an die "Goldmacher" und die "Hexen".
Sibylla war es sehr schnell völlig klar geworden, welche "Einstellung" Friedrich gegenüber Frauen besaß!
Es gehörte wohl zu seinem Selbstverständnis als "herrschender Fürst" seine "Männlichkeit" durch zahlreiche Mätressen zu demonstrieren. Zudem symbolisierte dies auch Status, Reichtum und Macht und diente somit der Kultivierung seines Selbstbildes. Wichtig war nur, dass er sich nicht dem Vorwurf aussetzte, zu sehr von den Reizen seiner Mätressen abhängig zu sein. Auffallend bei Friedrichs Mätressen ist, dass (soweit sie bekannt wurden) sie alle sehr jung und jungfräulich waren.
Hier spiegelt sich schon früh der Zeitgeist des nachfolgenden Absolutismus wider.
Wie Friedrich zu seiner Frau stand, zeigt auch der nachfolgend geschilderte Vorgang.
Am 26. Januar 1604 schrieb Herzogin Sibylla an Prälaten und Landschaft (Originaltext in lesbares Deutsch übersetzt - Landtagsakten Band II/2 - 1911):
Meinen freundlichen Gruß
zuvor an die würdigen, hochgeehrten lieben Getreuen.
Ich kann Euch meine dringende Not nicht verbergen:
Wegen der fürstlichen Hochzeit meiner Tochter in Sachsen bin ich in große
Bedrängnis geraten. Wie es sich fürstlich ziemt, habe ich verschiedene
Ausgaben für Geschenke und anderes getätigt, was zu einem fürstlichen
Haushalt und Auftreten gehört. Dabei war es keineswegs meine Absicht, mich
damit einschmeicheln zu wollen, sondern den guten, überlieferten Namen des
fürstlichen Hauses Württemberg zu wahren. Mir ist auch nicht unbekannt, wie
es zu Lebzeiten des frommen, christlichen Fürsten Herzog Christoph seligen
Angedenkens bei der Ausstattung seiner Tochter gehandhabt wurde. Daher
hoffte ich, dass man auch jetzt dem bewährten württembergischen Brauch
folgen würde.
Nun aber ist mir wider Erwarten vor wenigen Tagen
von meinem Herrn beschieden worden: Wenn ich viel ausgegeben habe, solle ich
auch viel bezahlen; zudem sei den Landschreibern streng befohlen worden,
nichts von dem zu erstatten, was ich ausgelegt habe.
Da Euch allen wohlbekannt ist, wie gering mein
jährliches Einkommen ist
(Siehe: ANMERKUNG) und wie schwer mir solche Last fällt, bitte und
ersuche ich Euch: Nehmt Euch in dieser Sache meiner an — der bedrängten Landesmutter — und verlasst mich nicht. Nach Gott setze ich
meine Zuflucht zu Euch, den getreuen Ständen des Landes. Als Sicherheit
bin ich bereit, einen Teil meines Schmucks
zu verpfänden. Ich vertraue fest, dass Ihr
mein Bitten nicht abschlagt, sondern Euch — wie bisher — willfährig erweist.
Das werde ich Euch gemeinsam mit meinen herzliebsten Kindern in Dankbarkeit
erkennen lassen; und ich empfehle Euch der starken Bewahrung Gottes.
Datum …
Eure gnädige Fürstin und Landesmutter
Sibylla, Herzogin zu Württemberg
(Beilegezettel:) Weil es um
mein Kind geht, gewährt mir bitte
3000 fl.
(Gulden). Lasst es mir nicht zum Nachteil gereichen; was mir die gesamte
Landschaft vorschießt, soll ordnungsgemäß in die Rechnung eingestellt
werden.
Sibylla,
Herzogin zu Württemberg
Friedrich hat also zunächst seine Frau "auflaufen" lassen - siehe den rot markierten Text. Man bedenke, wie großzügig er Geld an seine Goldmacher verschwendet hatte und hier geht es doch um die Hochzeit und Ausstattung seiner Tochter Sibylla Elisabeth.
Am 6./17. Mai fand in Stuttgart die feierliche Werbung um Sibylla Elisabeth (geb. 20. April 1584, gest. 20. Januar 1606), die älteste Tochter Herzog Friedrichs, für Herzog Johann Georg von Sachsen (Bruder des regierenden Kurfürsten, selbst Kurfürst 1611–1616) statt. Als der Termin dann vor der Tür stand, hat Herzog Friedrich sich dann doch noch neu besonnen:
Nr. 216 — Herzog Friedrich an die Landeseinnehmer, 14. Mai 1604:
Nachdem Unser
gnädiger
Fürst und Herr zu der genannten
fürstlichen Heiratsausführung in gewisser Eile eine größere Geldsumme
benötigt, ist [I.F.G. = Ihro Fürstliche Gnaden] Meinung, dass die
Landeseinnehmer diesmal darlehensweise in gängigen Sorten 6 000 Gulden
liefern und vorstrecken sollen. Diese Summe wolle man ihnen baldmöglichst
wieder erstatten und sie deshalb gegen die gemeine Landschaft vertreten.
Actum etc. Friderich.
I
Es wurde damals durch Herrn Dr. Enzlin im Namen [I.F.G.] in Erinnerung gebracht: Nachdem Fräulein Sibylla Elisabeth mit Herrn Johann Georg, Herzog zu Sachsen, vermählt sei und das fürstliche Beilager noch vor dem Herbst erfolgen werde, solle sich die gehorsame Landschaft inzwischen darauf einrichten, damit sie — wie sie verpflichtet ist — die festgesetzte Aussteuer von 32 000 Gulden entrichten könne.
Die finanzielle Notlage von Sibylla war somit doch noch "abgewendet" worden. Der Vorgang macht es aber drastisch deutlich: Das Ehepaar hatte sich 1604 gewaltig auseinandergelebt!
Beachtenswert ist auch, dass Siyblla ihren Gemahl als "ihren Herrn" bezeichnet und dass sie auf die Landstände hofft und vertraut, die Friedrich am liebsten sofort abgeschafft hätte. (10)
Er war auch in seiner Ehe bestrebt, alle Ausgaben peinlich genau zu kontrollieren.
Sibylla schrieb in
diesen
Wochen
der oben erwähnten Hochzeitsplanung
mehrere
lange
Briefe
an
Friedrich,
in
denen
sie
über
die
Vorbereitungen
verhandelte,
und
aus
diesen geht
hervor,
dass
Friedrich
über
jedes
Detail
entscheiden
wollte.
So räumte Sibylla widerwillig ein, dass sie nur fünf Hofdamen mitnehmen würde, um sie und ihre Tochter zu begleiten, obwohl sie "nicht wusste, wie das aussehen würde". Friedrich widersetzte sich auch ihren Vorschlägen für die Anzahl und Art der Hochzeitskränze. Schließlich ging sie jedoch weiter und gab ein nicht näher spezifiziertes Geschenk für das Brautpaar in Auftrag. ohne Friedrich zu konsultieren. Da er alle Ausgaben akribisch überprüfte, erfuhr er schließlich einige Monate nach der Hochzeit davon und war empört:
"Wir fragten den Juwelier, der uns Bescheid gab ... dass Sie den Zettel selbst unterschrieben haben, und nun möchten wir wissen, wer Ihnen während dieses Brautzuges die Macht gegeben hat, dieses Geschenk zu überwachen, [...] Ich lasse dich nur als Brautmutter kommen." Und weiter, ..."hett wir lust zu dir hinauf zu gehn vnd dich so zu trackhtiren, dz dich zu künfftig dergleichen nicht gelingen solt, weder vnseren befelh dich so gröblich zu verhalten". (HStAS G 60 Bü 9, letter from Friedrich to Sibylla, 23 Jan. 1605 - Zitiert nach 11)
Also hat er seiner Frau "Prügel" angedroht, weil sie es gewagt hatte, ihn zu übergehen!
Noch schlimmer drohte er ihr im Juni 1606, als er erfuhr, dass sie 2435 fl Schulden hatte:
"Deshalb hüte dich wohl, dass ich nicht noch was Gewisses erfahre. Sonst ist es bei Gott mit dir aus!" (12, Seite 169/170)
Auch verbot er ihr den weiteren Briefwechsel mit dem Hofprediger E. Grüninger, weil er befürchtete, dass sie sich bei diesem über Friedrichs Verhalten beklagt hatte.(12, Seite 170)
Ein weiterer Zerrüttungspunkt beinhaltete den Vorwurf von Friedrich, Sibylla hetze ihre gemeinsame Tochter gegen ihn auf, weil diese sich nicht von ihm verabschiedet hatte. Dabei hätte er ihr doch nur einen "Streich" gegeben und es sonst "gut" mit ihr gemeint! (12, Seite 171)
Friedrich begann auch irgendwann, seiner Frau zu misstrauen.
Georg Göller [von Leinach und Waldschach], wohl aus Graz, war 1606 für kurze Zeit sein Landhofmeister. Er wurde ab dem 22.12.1606 „wegen Unverträglichkeit...aus dem Land geschafft“. Der Landhofmeister war der höchste weltliche Beamte und Stellvertreter des Herzogs. Dazu Sattler:
"Es ereignete sich eben damals auch einige Zerrüttung in der herzoglichen Familie, welche bei dem ganzen Hofstaat einen Einfluss hatte, wobei sein Landhofmeister, Georg Göler in solche Ungnade fiel, dass ihm angewiesen wurde innerhalb acht Tagen das Herzogthum zu verlassen und der Herzog entfernete sich von seiner Residenz."(1, Seite 296, §79)
Die "Unverträglichkeit" beziehen
die Chronisten auf das gute Verhältnis von Göller zur Herzogin. So auch bei
Pfaff, Seite 51, wobei dieser offen lässt, ob Hofränke oder Eifersucht zu
diesem Schritt des Herzogs geführt hat.
(2) (Siehe dazu auch die Landtagsakten
Seite
546 vom 13. Januur 1607
Neben diesen Demütigungen hatte Sibylla vor allem durch die Verbindung des Herzogs zu Magdalena Möringer in Urach zu leiden, die dort als Kupplerin für ihn tätig war und drei miteinander konkurrierenden Mätressen für ihn bereit hielt.(5)
Zu ihr muss der Herzog einen besonderen, vor allem regelmäßigen, Kontakt gepflegt haben, denn augenscheinlich landeten auch Schmuckstücke aus Sibyllas Besitz bei der Möringer als Belohnung für ihre Dienste.
Außerdem war sie auch Gast bei der Investitur des Hosenbandordens in Stuttgart (1603) und hat sich mit dem Herzog über das Fest und über Sibylla ausgetauscht.(5) Die Briefe jedoch, die sie von Friedrich erhalten hatte, wurden ihr, soweit sie gefunden wurden, alle abgenommen.
Mit einer Urkunde vom 11. Mai 1605 hatte Friedrich zudem der Möringer einen Freisitzprivileg verschafft. Sie solle "aller Dienst, Wacht, Fronens und Raysens ...frey sein...Ihre Haab und Guetter weiter kein Steur oder Anlaag..." (5, Seite 51) belegt werden.
Aus den Prozessakten in Speyer, "Möringer gegen das Fürstenhaus", geht außerdem hervor, dass Herzog Friedrich mit einer der Uracher Mätressen, "Catharina von Miltitz", einen unehelichen Sohn gezeugt hatte, der bald danach gestorben war. Auf Befehl des Herzogs übernahm die Möringer die Kosten für die Beisetzung in der Uracher Kirche! Das zeigt, dass der Herzog und sie eine absolutes "Vertrauensverhältnis" verband, ja man könnte formulieren, sie agierte in seinem Auftrag als "Nebenfrau" des Herzogs !.
Catharina
von
Miltitz wurde
1607
mit
Jost
Weickhmann
(einen
Cousin
von
Ursula
Weickhmann, eine weitere Mätresse in Urach) verheiratet, was wiederum
von M. Möringer arrangiert wurde. Jost
wurde zum
Obervogt
von
Blaubeuren
ernannt,
und
so
erhielt
das
Ehepaar
zumindest
vorübergehend
eine
sichere
Stellung
im
herzoglichem
Amt.
(4)
Magdalena Möringer versuchte später in mehreren Briefen sich bei Sibylla zu entschuldigen. Sie fürchtete sich vor dem Hass der Herzogin und ihres Sohnes Johann Friedrich. Sie bat um Vergebung für alles, womit sie die Herzoginwitwe und ihren Sohn erzürnt haben sollte. Der Herzog (Johann Friedrich) sei
"doch keiner (anderen) under allen so feind als ihr".(5, Seite 57)Die Herzoginwitwe und Johann Friedrich aber hielten sich genau an die Ratschläge von Geheimrat Melchior Jäger und der anderen Räte, nahmen der Möringer ihren Besitz, bestraften sie mit jahrelangem Gefängnis und legten ihr zuletzt Stillschweigen auf.
Ein weiteres illegitimes Kind von Friedrich, "Christoph", soll schon 1590 in Stuttgart auf die Welt gekommen sein. (12, Seite 172) Näheres erfährt man jedoch nicht.
Außerdem benennt Paul Sauer noch eine Tochter, die erst nach dem Tod von Friedrich auf der Feste Hellenstein das Licht der Welt erblickte. Die Mutter. Anna Maria, war dort die Frau des Zeugwarts Michael Heintz. Die Tochter erhielt den Namen "Sibylla", die Herzoginwitwe hat die Patenschaft übernommen! (12, Seite 173)
Der Verursacher allen Leides der Herzogin war Friedrich, dessen Ruf jedoch sollte unbedingt geschützt werden, koste es, was es wolle.
Tatsächlich verloren dabei auch sekundär Mitbeteiligte ihr Leben. Auch eine Hinrichtung von M. Möringer war in Betracht gezogen worden, dies wurde aber wegen des möglichen "Aufsehens" wieder verworfen!
Da der "Hof" und damit immer auch das Volk die wahren Zusammenhänge kannten, verwundert es, dass Sibylla, Johann Friedrich und die Räte tatsächlich daran geglaubt hatten, dass ihre "Vertuschungsversuche" erfolgreich sein könnten.
Letztlich wirkte allein der "Strafcharakter" all ihrer Maßnahmen und führte zur Zerstörung vieler familiärer Existenzen.
Geheim geblieben sind lediglich "Details" von Friedrichs Affären. Aber es wurde übermittelt, dass es 13 Mätressen für Friedrich gegeben haben soll. Diese Zahl geht auf einen Bericht des Peter de Vischere, Agent des Erzherzog Albrechts zurück. Dieser berichtete am 11.3.1608: „Die Wittwe und sein Sohn haben seine dreizehn Concubinen einsperren lassen.“ (12, Seite 172)
Vischere berichtete als habsburgischer Agent über württembergische Hofangelegenheiten. Er taucht in Aktenzitaten auf, u. a. mit einer Notiz vom 11. März 1608 (HStAS, Stuttgart), die Gerhard Raff zitiert. Das weist auf seine Informationsarbeit zum Stuttgarter Hof hin.(Zit. nach: R. Blank, 4)
Sibylla hatte um 1596 begonnen ihr eigenes Leben zu führen. Trotz einer zerrütteten Ehe gelang es ihr für Notleidende einen medizinischen Dienst einzurichten. Ihre umfangreiche Bibliothek bewies ein weitreichendes Interesse an Botanik, Chemie und Alchemie. Ihr umfangreiches und praktisches Wissen nutzte sie zur Arzneimittelherstellung.
Dies kam dann der Stuttgarter Hofapotheke zugute. Deren Geschichte hatte schon 1413 begonnen. Arzneiabgaben durften damals nur an den Grafen Eberhard IV. von Württemberg und seine Frau Henriette von Mömpelgard, den Hof und die Kanzlei erfolgen. Aber 150 Jahre später im Jahr 1551, wurde die Apotheke von Markgräfin Anna Maria von Brandenburg-Ansbach, der Gemahlin Herzog Christophs von Württemberg, als eine Stiftung ins Leben gerufen, „um“ – wie es in den Gründungsurkunden heißt – „die Kranken mit Arzneien zu versehen“.
Es handelte sich um eine Stiftung für Arme, Kranke und Notleidende der Stadt. Später wurde u. a. das königliche Waisenhaus mit kostenlosen Medikamenten versorgt.
 Neben Anna Maria von Brandenburg spielten auch
andere Frauen eine Rolle in der Geschichte der Hof-Apotheke. 1582 wurde
Helene Ruckher zur Hof-Apothekerin ernannt, sie leitete 12 Jahre die
Apotheke bis zu ihrem selbstgewählten Ruhestand. Ihr folgten weitere
Apothekerinnen, die aber zumeist im Gefolge der Herzogin waren, wie z.B.
Maria Andreae in Verbund mit Sibylla.
Neben Anna Maria von Brandenburg spielten auch
andere Frauen eine Rolle in der Geschichte der Hof-Apotheke. 1582 wurde
Helene Ruckher zur Hof-Apothekerin ernannt, sie leitete 12 Jahre die
Apotheke bis zu ihrem selbstgewählten Ruhestand. Ihr folgten weitere
Apothekerinnen, die aber zumeist im Gefolge der Herzogin waren, wie z.B.
Maria Andreae in Verbund mit Sibylla.
Ihre Tätigkeit in der Hofapotheke und später an ihrem Witwensitz in Leonberg beschreibt Ruth Egger ausführlich in einem Blog des Landesmuseum in Stuttgart. Siehe: (7)
Nachstehend daraus eine kurze Zusammenfassung:
Als Friedrich I. ab 1594 den heutigen Schillerplatz errichtete, befand sich die Hofapotheke im Erdgeschoss des Schlosses. Die Herzogin hatte im Ostflügel des zweiten Obergeschosses ihre eigene Apotheke.
Sibylla berief 1606 die mittlerweile verwitwete Pfarrersgattin Maria Andreae (1550–1632) als Hofapothekerin nach Stuttgart. Über ihre Ehemänner hatten sich die beiden Frauen bereits 1598 in Königsbronn kennengelernt. Sie wurden eine enge Vertraute, was vielleicht an einem ähnlichen Schicksal lag.
Auch Maria hatte früh ihre Mutter verloren und wuchs anschließend bei ihrer Großmutter auf. Diese betrieb im Herrenberger Vogtshaus eine kleine Krankenstation. Wie der Herzog beschäftigte sich ihr Ehemann, der Theologe Johannes Andreae (1554–1601), vornehmlich mit Alchemie und verprasste dafür das Vermögen der Familie.
 Sibylla musste zuerst die Finanzen der
Hofapotheke sanieren, denn Herzog Friedrich hatte mit der Kasse seine Goldmacher bezahlt.
Auch mittellose Kranke konnten nun kostenlos vom Stadtarzt
behandelt werden.
Sibylla musste zuerst die Finanzen der
Hofapotheke sanieren, denn Herzog Friedrich hatte mit der Kasse seine Goldmacher bezahlt.
Auch mittellose Kranke konnten nun kostenlos vom Stadtarzt
behandelt werden.
Für Frauen in der Frühen Neuzeit war eine wissenschaftliche Betätigung nur eingeschränkt möglich. Sibylla nutzte deshalb ihre monetären Mittel und ihre soziale Stellung, um eine eigene Bibliothek anzulegen. Ihr Bibliothekskatalog verzeichnet mehr als 300 Titel aus den Bereichen Theologie, Geschichte und Medizin. Neben Helene Ruckhers „Artzneybuch“ besaß Sibylla mehrere Kräuter- und Kochbücher, sowie paracelsische und alchemistische Literatur.
 Nach dem Tod des Ehemanns
im Jahr 1608 zog sich Sibylla auf ihren Witwensitz im Schloss Leonberg
zurück und erfüllte sich dort den Traum eines eigenen Gartens.
Nach dem Tod des Ehemanns
im Jahr 1608 zog sich Sibylla auf ihren Witwensitz im Schloss Leonberg
zurück und erfüllte sich dort den Traum eines eigenen Gartens.
Der Hofbaumeister Heinrich Schickhardt (1558–1635) wurde mit dem Bau des Pomeranzengartens beauftragt. Die namensgebenden Pomeranzen (Bitterorangen) waren damals ein Statussymbol und wurden für Heilzwecke verwendet. Gemeinsam mit Maria Andreae pflanzte sie in ihrem Garten schöne und seltene Pflanzen neben Heilpflanzen für ihre Arzneien.
Der Pomeranzengarten wurde zum Vorbild späterer wissenschaftlicher Gärten wie dem berühmten Hortus Palatinus in Heidelberg.
Sibylla verstarb 1614 im Alter von 50 Jahren in Leonberg. In seiner Leichenpredigt pries der Theologe Erasmus Grüninger (1566–1631) Sibyllas „liberal Gemüth, auch recht heroisches großmüthiges Hertz, [… und] sehr scharffsinnigen hohen Verstand“.(3, Seite 59)
Letzte Änderung: 18.10.2025
Im Artikel von Ruth Blank (4) befindet sich auf Seite 63 die irreführende Angabe "...nämlich die Schulmeisterin in Freudenstadt und die Ketterlin im Harnischhaus..." und zwei Zeilen später: "Anna Maria im Harnischhaus.." - (Sie war die Ehefrau von Hans Jacob Stählin.)
Ketterlin war die Schulmeisterin in Freudenstadt, sie war nie im Harnischhaus!
Hier liegt wahrscheinlich ein "Setzfehler" im Artikel vor.
Die ursprüngliche Stauferburg wurde zwischen 1130 und 1145 erbaut, jedoch bei einem Brand im Jahre 1530 fast völlig zerstört. Nur noch die Ruinen des so genannten Rittersaals sind davon übrig geblieben. Sie bilden heute den stimmungsvollen Rahmen für die jährlich stattfindenden Opernfestspiele. Vor diesem mittelalterlichen Gebäudekomplex ließ Herzog Friedrich I. ab 1598 ein Renaissanceschloss bauen. Es entstand eine Festung mit mächtigen Rondellen und Basteien. Elias Gunzenhäuser errichtete 1605 die Schlosskirche.
Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hellenstein#/media/Datei:Das_Schloss_Hellenstein.jpg
Hinweis:
Auf Youtube kann man zum Thema dieser Seite folgenden Film finden:
"Herzogin Sibylla (gest. 1614) - Bitteres für die Herzogin"https://www.youtube.com/watch?v=LkFzsphWgo0
Bilder (Public Domain):
Mitte: Herzog Friedrich I. und seine
Ehefrau Sibylla von Anhalt.
Links von oben ihre fünf Söhne:
Johann Friedrich (1582-1628), Ludwig Friedrich (1586-1631), Julius
Friedrich (Württemberg-Weiltingen) (1588-1635), Friedrich Achilles
(Württemberg-Neuenstadt) (1591-1631), Magnus
(Württemberg-Neuenbürg)(1594-1622).
Rechts von oben ihre fünf
Töchter:
Schwiegertochter und Frau von Johann Friedrich Barbara
Sophia von Brandenburg, Sibylla Elisabeth (1584-1606), Eva Christina
(1590-1657), Agnes (1592-1629), Barbara (1593-1627), Anna (1597-1650).
Das Bild der jugendlichen Sibylla stammt von KI
Aus den Akten der Hofschatzkammer geht hervor, dass die Ausgaben für das "Frauenzimmer" während der Herrschaft Friedrichs mit durchschnittlich nur 69 Gulden und 12 Kreuzern pro Jahr sehr gering waren.
Diese Zahl sollte auf mehr als das Zwanzigfache ansteigen, als Friedrichs Sohn Johann Friedrich den Thron bestieg und seiner Frau eine wesentlich größere finanzielle Unabhängigkeit gewährte.
Quellen:
Christian Friedrich Sattler, 1772,
Geschichte des Herzogtums Würtenberg unter der Regierung der Herzogen. Fünfter Theil. Mit 45. Urkunden und einigen Kupfern bestärket
Karl Pfaff, 1839
Geschichte des Fürstenhauses und Landes Wirtemberg, nach den besten Quellen und Hülfsmitteln neu bearbeitet von Dr. Karl Pfaff,
Gerhard Raff: Hi gut Wirtemberg allewege II, 1993
Ruth Blank: Margaretha Matthiä, Ursula Dorothea Linder, Sabine Scheying-drei
Kupplerinnen in Diensten Herzog Friedrichs v. Württemberg - in: Südwestdeutsche
Blätter für Familien- und Wappenkunde Band 29 · 2011, Seite 63 ff.
https://regionalia.blb-karlsruhe.de/files/26236/BLB_SWDB_2011.pdf
Ruth Blank: Magdalena Möringer: Eine Gefangene auf der Festung Hohenurach - Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, 65. Jahrgang, 2006, Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, Seite 49 -95
Die Apotheke der Herzogin im Alten Schloss: Sibylla
von Anhalt und die Arzneimittelherstellung
Freudenstädter Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde zwischen Neckar, Murg
und Kinzig:
Herzog Friedrichs Freudenstadt im ersten Jahrhundert seiner Geschichte, Nr.
6/1987 - aus:"Freudenstädter Heimatblätter" 1949-1994, Ergänzte 2. Auflage 1997
Hrsgb.: Heimat- und Museumsverein für Stadt und Kreis Freudenstadt
Gustav Lang: Landprokurator Georg Esslinger in "Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte", 5. Jahrgang, 1941, Kohlhammer, Stuttgart, Seite 34 ff.
WÜRTTEMBERGISCHE LANDTAGSAKTEN, Herausgegeben von
der
Württembergisehen Kommission für Landesgeschichte, II. Reihe, Zweiter
Band: 1599 — 1608
Link:
Regine Maritz:
Die Favoriten des Herzogs: Auf dem Weg zu
einer geschlechtsspezifischen Sicht auf die Politik des Konkubinats am
frühneuzeitlichen Hof, 2015
R. Maritz ist heute Mitarbeiterin an der Uni Fribourg.
Paul Sauer: Herzog Friedrich I. von Würtemberg, 1557 - 1608, Reformer und Autokrat, Deutsche Verlagsanstalt, München, 2003
|
Freudenstädter- Marktplatz-Geschichten 5_1: Szenen einer Ehe Nächster Abschnitt: 5_2: Das verinnerlichte Konzept |
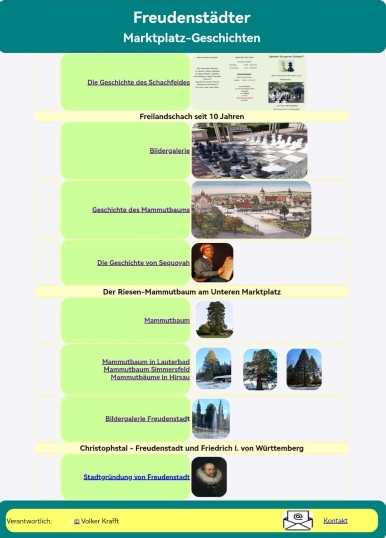 |
|
Verantwortlich: © Volker Krafft |
Seite im pdf-Format: Link
Besucher seit 10.07.2025: 0000560
Online: 1