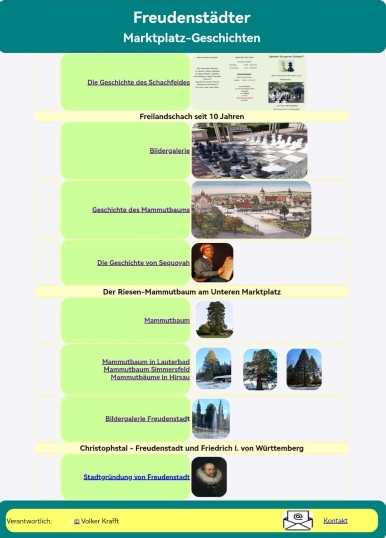Nach dem Chronisten verblieben
also nur noch 12 Jahre von ca. 100, die er als "normale", bzw.
"erwartbare" Jahre beschreibt, im Gegensatz dazu vermeldet er 93
negative Ereignisse (Phänomene) in den anderen Jahren.
Leider ist nicht vermerkt, welches Schicksal die
siamesischen Zwillingen von 1542 erlitten haben.
Besonders hervorheben muss man den Kometen
"C/1577 V1"
der um den
Jahreswechsel 1577/1578 auch am Tage mit
dem bloßen Auge gesehen werden
konnte. Er wird aufgrund seiner außerordentlichen Helligkeit zu
den „Großen Kometen“ gezählt. Er war ein besonderes
Studienobjekt von Tycho Brahe.
Auch der
Komet "C/1618 W1" konnte in den Jahren 1618 und 1619 mit
dem bloßen Auge gesehen werden. Er wird aufgrund seiner
außerordentlichen Helligkeit und seines bis zu 90° langen
Schweifs auch zu den „Großen Kometen“
gezählt.(2)
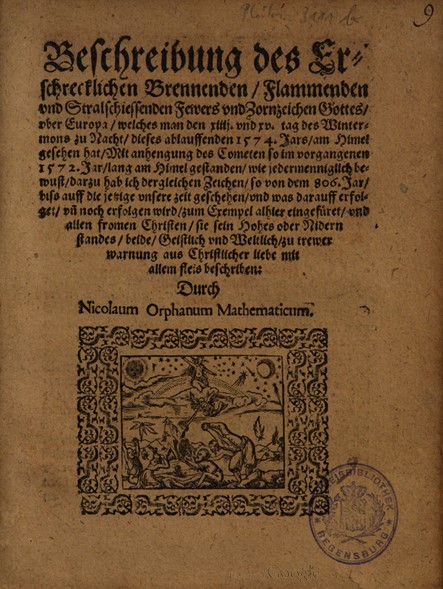 Auf manche Ereignisse folgten prompt Schriften zur Ermahnung
aller zum "christlichen, bußfertigen Leben" um dem Zorn Gottes zu entgehen.
Hier sind links und rechts solche Reaktionen auf die Jahre 1572, 1574 und
1618 abgebildet.
Auf manche Ereignisse folgten prompt Schriften zur Ermahnung
aller zum "christlichen, bußfertigen Leben" um dem Zorn Gottes zu entgehen.
Hier sind links und rechts solche Reaktionen auf die Jahre 1572, 1574 und
1618 abgebildet.
Die Kometen werden darin als Zeichen für Tod, Veränderungen und
bevorstehenden Krieg
gedeutet.
Das starke
Erdbeben im Jahre 1601
ging von Unterwalden (nahe der Stadt Luzern) aus. Es wird
auf Magnitude 5.8 geschätzt und ist damit eines der stärksten
Erdbeben in der Geschichte der Schweiz. Es verursachte schwere
Schäden und Erdrutsche. Auch im Raum Konstanz kam es zu
Gebäudeschäden. Es war auch in Süddeutschland zu spüren und
hatte wahrscheinlich kleinere Nachbeben zur Folge. Sattler
beschreibt zusätzlich ein Beben vom 10. September 1603, bei dem der "Neue Bau"
in Stuttgart, begonnen 1599, wieder einstürzte.(3)
Natürlich konnte man sich damals
einen "Blutregen" (1623 - Niederschlag mit Saharastaub vermengt)
nicht erklären. Genauso wenig das Entstehen von Blutwasser
(1583 - in Beilstein), das entweder durch Ausschwemmungen im roten
(Heilbronner) Sandstein oder durch
Mikroalgen der Art "Haematococcus pluvialis"(4) entstanden sein
muss. Diese Mikroalgen bilden sich in ausgetrockneten Gewässern
und werden als Staub mit dem Wind verweht, um irgendwo anders mit
dem Regen wieder auf dem Boden zu landen. Dabei traut man ihnen
auch längere Reisen zu.
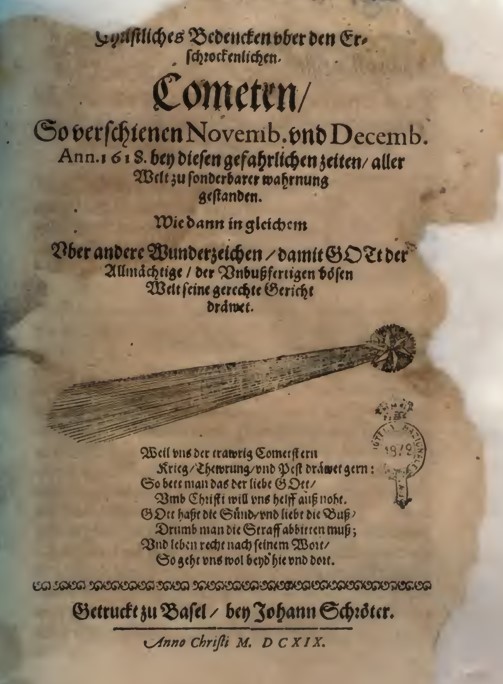
Allein schon der große Brand in Stuttgart (1574), dem 74 Häuser
zum Opfer fielen, löste
die damals gängige Reaktion aus, dass man nämlich eine "Hexe" als
Verursacherin suchte, natürlich auch fand und verbrannte.
Ähnliches ereignete sich in Schiltach 1590, das 1533 schon
einmal durch ein Feuer total zerstört worden war. Lesenswertes
dazu findet man bei Hans Harter: "Der Teufel von Schiltach" -
mit zahlreichen Quellenangaben - hier im Internet abrufbar: (7)
Diesem Vorgehen boten auch die Kirchen beider Konfessionen
keinen Einhalt. Im Gegenteil: Zahlreiche Predigten dieser Zeit
bezeugen, dass der Hexenwahn auch von den Kanzeln herab
legitimiert wurde. Überall lauerte der "Böse". Dazu findet man
zahlreiche Quellen. Eine sei hier dargestellt:
In der links stehenden Sammlung von M. Bernado
Waldschmidt, Evangelischer Prediger aus dem Jahr 1660 sind
nicht weniger als 28 Predigten zu Thema "Hexen und Gespenster"
vereint. Dies ist nur eines von zahlreichen Beispielen aus
der Zeit um 1600.
Allen Predigten haben eine Gemeinsamkeit: Sie liefern mit Berufung auf Texte aus
dem Alten Testament zahlreiche Begründungen dafür, warum
"Hexen" und alle anderen "Unholde" getötet, meist verbrannt
werden müssen. Nur dieses Vorgehen wird als "die gerechte Strafe"
für Hexen angesehen. Anders
kann dem Wirken des Teufels nicht begegnet werden.
So erhält der Begriff der "Ausrottung" in diesen Zeiten eine Legitimation durch
die "Religion" und dieses Denken wirkte noch jahrhundertelang nach - bis zum Holocaust.
In der Regel berufen sich die "Seelsorger" unter anderem auf das 2. Buch Mose,
XXII, Vers 18 und zitieren: "Eine Hexe sollst du nicht leben
lassen"!
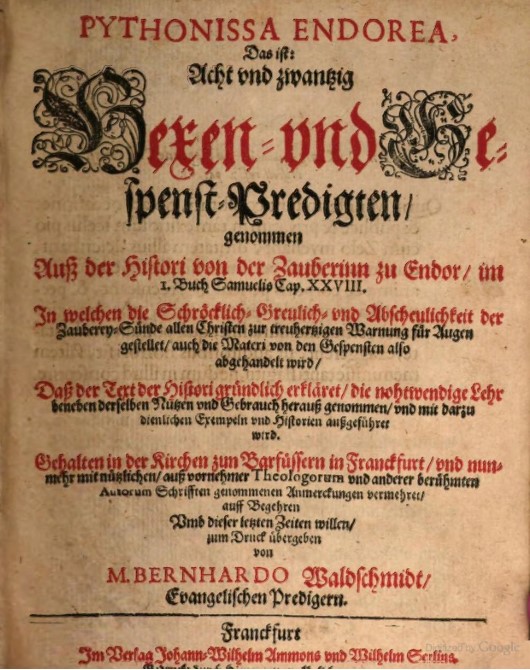 Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch
das Wetter verantwortlich sind, wird durch die
"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel
entschieden.
Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch
das Wetter verantwortlich sind, wird durch die
"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel
entschieden.
Die Gegner des Hexenglaubens fochten einen jahrhundertelangen
Kampf, um eine Wende im Gedankengut des Volkes zu erreichen.
Einer der ersten von ihnen war Johann Weyer (1515-1585), der Leibarzt des
Herzogs Wilhelm III. von Jülich-Kleve-Berg. Weyer war ein Rufer im
Streite gegen Aberglauben, Grausamkeit und unaufhörliche
Rechtsmorde. Seine
1563 erstmals gedruckte Dämonologie "De
praestigiis daemonum" („Von
den Blendwerken der Dämonen“) wurde zum
Grundlagenwerk für alle Gegner der Hexenprozesse.
Weyer war auch einer der ersten, die sich gegen den Hexenhammer wandten.
Näheres findet man bei Wikipedia und hier:(5)
Als früher Kämpfer gegen Hexenwahn
und Folter muss auch Anton Praetorius (1560-1613), badischer
Pfarrer in Laudenbach an der Bergstraße, genannt werden. Er hat
zahlreiche Schriften gegen Folter und Hexenprozesse verfasst.
Dabei schrieb er bis 1602 unter dem Pseudonym seines Sohnes
"Johannes Scultetus", erst danach traute er sich,
seinen wahren Namen zu benutzen.(6)
Auch die Bewertung der Himmelsereignisse änderte sich nur sehr
langsam.
Ausgehend von Johannes Keplers Mentor, Michael Maestlin
(1550-1631), Keppler selbst (1571-1630 ), Tycho
Brahe(1546-1601), Galileo Galilei(1564-1641) und Isaac Newton
(1642-1726) setzte sich allmählich eine neue Sichtweise zu
allen Erscheinungen am Himmel durch.
Sie alle entwickelten die Erkenntnisse von Nikolaus Kopernikus
(1473-1543) und sein heliozentrisches Weltbild weiter, dessen Werk noch 1616 von der Kirche verboten
wurde. Kopernikus selbst musste als gebrandmarkter
"Gotteslästerer" um sein Leben fürchten, denn die Kirche wollte
weiterhin das Monopol auf die Deutung von "Gottes Wille und
Werk" behalten.
Das Verbot von 1616 wurde erst 1835 zurückgenommen.
Andere hatten nicht soviel Glück.
Giordano Bruno (1548-1600), der sich wohl als erster ein
"grenzenloses Universum" vorstellte und der Gott in allen
Dingen der Natur wähnte (diese Vorstellung wird später
"Pantheismus" genannt), wurde für dieses Gedankengut im Jahr
1600 als "Ketzer" von der Kirche hingerichtet.
Letzte Änderung: 08.05.2025
Quellen:
(1)
Narcisso Schwelin: Chronik mit einer
7-seitigen Beschreibung der Stadt Stuttgart, sonst mit dem
Schwerpunkt der Wirtschaft und Weinbau und ab S. 546 die Beschreibung der
köstlichen Suauerbronnen im Lande :Deinacher Saurbrunn,
Wunder-Brunn zu Boll, Göppinger Saurbrunn,
Ebenhauser-Sauerbrunn, Wild-Bad, Zeller- Bad, Sultz-Waser bey
Cantstatt, Bläsi-Bad bei Tübingen.
Internetadresse:
https://books.google.de/books?id=u34AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
(2)
Wikipedia
(3)
https://books.google.de/books/about/Geschichte_des_herzogthums_W%C3%BCrtenberg_u.html?id=3GxHAAAAYAAJ&redir_esc=y
Google-Books stellt dankenswerter Weise die älteste verfügbare Gesamtübersicht
zur Verfügung.
C.
F. Sattler, 1772 :
Geschichte des herzogthums Würtenberg unter der regierung der herzogen,
Bände 5-6, Seite 255
(4)
Wikipedia: Siehe Blutregenalge
(5)
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/inkur/nr_magazin_22_2016_01.pdf
(6)
https://regionalia.blb-karlsruhe.de/files/38/BLB_Hegeler_Praetorius.pdf
Dieter Kasang
https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/klimawandel/kleine-eiszeit-746676
(7)
/https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Themen/Hexenforschung/Themen_Texte/Regional/Teufel_komplett.pdf
oder:
http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/thementexte/regionale-hexenverfolgung/art/Der_Teufel_von/html/ca/49001e0343/
Bilder:
Bild_2_links: Verbindung von Tod, Türkenkrieg und Komet,
Wikipedia
Bild_3_rechts: Nürnberg, 1618, Wikipedia
Bild_4_rechts: Heidelberg, 1618, Wikipedia
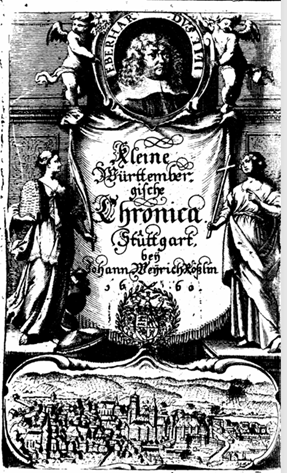

 Hier
werden die Jahre von 1543 bis 1638 ausgewählt, weil es danach eine kurze Stabilität des
Wetters gab. Ich versuche mit meiner Darstellung die Dichte der "Notjahre"
sichtbar zu machen. Die Zahlen in Klammern summieren die
Schadensjahre des gewählten Zeitraumes.
Hier
werden die Jahre von 1543 bis 1638 ausgewählt, weil es danach eine kurze Stabilität des
Wetters gab. Ich versuche mit meiner Darstellung die Dichte der "Notjahre"
sichtbar zu machen. Die Zahlen in Klammern summieren die
Schadensjahre des gewählten Zeitraumes.
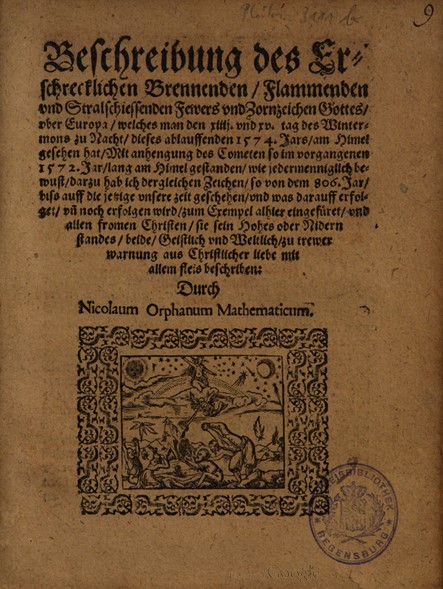
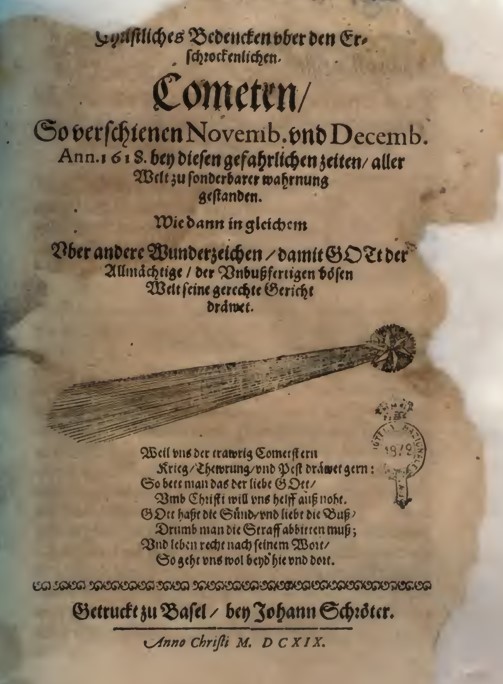
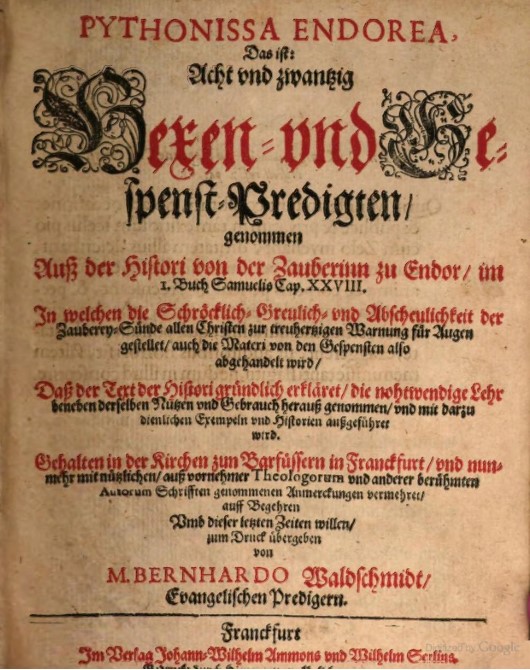 Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch
das Wetter verantwortlich sind, wird durch die
"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel
entschieden.
Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch
das Wetter verantwortlich sind, wird durch die
"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel
entschieden.